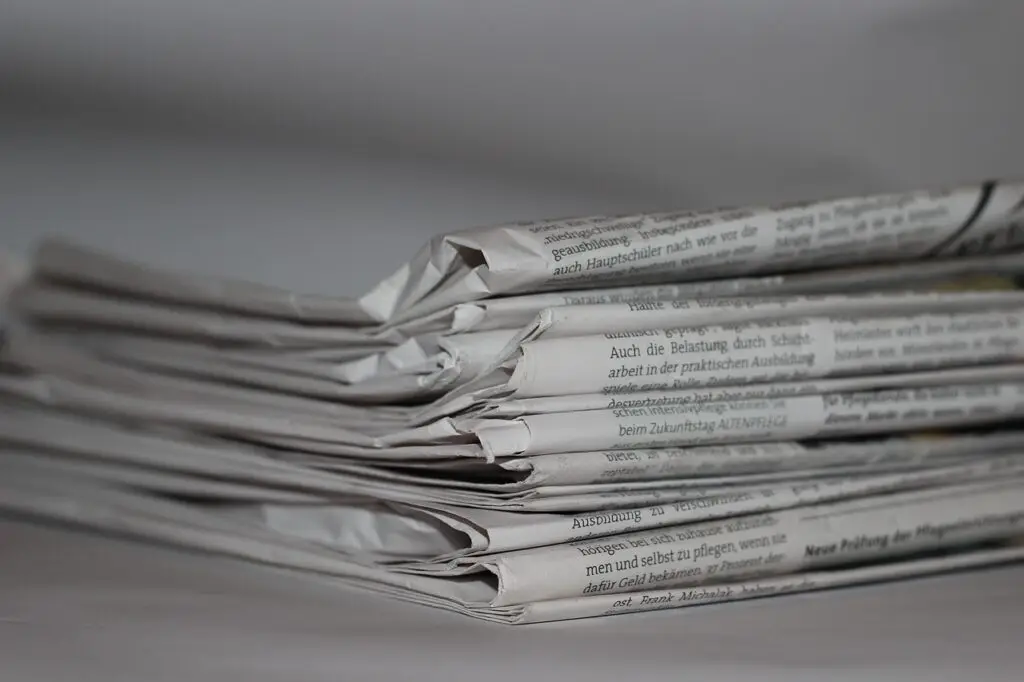Ein nichteheliches Kind des Erblassers, dessen Vaterschaft innerhalb der Verjährungsfrist nicht festgestellt ist, läuft Gefahr seine Ansprüche nicht durchsetzen zu können.
Das Problem:
Der BGH hatte kürzlich einen Fall zu entscheiden, in dem Pflichtteilsansprüche der nichtehelichen Tochter geltend gemacht wurden. Diese hatte erst fünf Jahre nach dem Tode des Erblassers im Jahr 2017 seine Vaterschaft feststellen lassen und sodann ihren Pflichtteil klageweise geltend gemacht, als das Vaterschaftsfeststellungsverfahren abgeschlossen war, die Klage wurde 2023 eingereicht. Der Beklagte war testamentarisch als Erbe eingesetzt und erhob die Einrede der Verjährung.
Die Vorinstanz
Pflichtteilsansprüche verjähren regelmäßig innerhalb von 3 Jahren (§199 BGB) seit Kenntnis über die anspruchsbegründenden Umstände. Das Berufungsgericht folgte dem Klageantrag, denn es nahm an, die nicht festgestellte Vaterschaft bis zum Ende des Feststellungsverfahrens hindere die Geltendmachung von Pflichtteilsansprüchen nach § 1600 d Abs. V BGB, denn danach können Rechtswirkungen der Vaterschaft erst nach der Feststellung geltend gemacht werden. So sei keine Verjährung eingetreten, denn der Anspruch der Klägerin sei erst nach Abschluss des vorausgegangenen Vaterschaftsfeststellungsverfahrens entstanden.
Die Entscheidung des BGH
Der BGH sah dies anders (BGH Urteil v. 12.03.2025, Az.: IV ZR 88/24). Er bestätigt zwar, die Klägerin gehört nach wirksamer Vaterschaftsfeststellung zum Kreis der Pflichtteilsberechtigten. Der Zeitpunkt der Entstehung des Pflichtteilsanspruchs ist aber nicht bis zur Rechtskraft der postmortalen Vaterschaftsfeststellung hinausgeschoben. Anders z. B. bei Unterhaltsansprüchen, die erst nach der Feststellung gerichtlich durchgesetzt werden können.
Das Entstehen des Pflichtteilsanspruchs
Grund ist der Wortlaut von § 2317 BGB, Pflichtteilsansprüche entstehen mit dem Erbfall und an das Entstehen des Anspruchs ist der Lauf der Verjährungsfrist geknüpft. Davon kann auch nicht abgewichen werden, wenn u. U. ein Verfahren nach § 1600 d BGB post mortem geführt werden muss und nicht innerhalb der Verjährungsfrist beendet werden kann. Einen völligen Ausschluss der Pflichtteilberechtigung bedeutet aber auch dies nach Auffassung des BGH nicht, denn es kommt für die Entstehung des Fristenlaufs darauf an, seit wann man Kenntnis der anspruchsbegründenden Tatsachen hat oder (grob) fahrlässig nicht hat. Zu diesen Tatsachen gehört neben dem Erbfall auch die Kenntnis über die beeinträchtigende letztwillige Verfügung sowie die familiäre Bindung zum Erblasser, aus der sich das Pflichtteilsrecht ergibt und die Person des Schuldners. Dabei kann die Kenntnis über die eigene Zeugung durchaus dahinstehen, es muss Kenntnis über die wirksame Anerkennung der Vaterschaft bestehen oder deren gerichtliche Feststellung. So soll nach dem Gesetz im Pflichtteilsrecht des nichtehelichen Kindes nicht allein die biologische Vaterschaft als Umstand für die Bemessung der Verjährung gelten, sondern auch die rechtliche.
Dabei wird nach Ansicht des BGH entscheidend darauf zu achten sein, ob aufgrund grob fahrlässiger Unkenntnis der den Anspruch begründenden Umstände davon auszugehen ist, dass das nichteheliche Kind seine Obliegenheit in eigenen Angelegenheiten und Anspruchsverfolgung verletzt hat, was immer dann der Fall ist, wenn das Vaterschaftsfeststellungsverfahren schon früher hätte betrieben werden können.
Fazit
Allen nichtehelichen Kindern sei damit empfohlen, die Vaterschaftsfeststellung so früh wie möglich zu betreiben, wenn sie nicht auf unsicherere Instrumente wie die gleichzeitige gerichtliche Verfolgung von Vaterschaft und Pflichtteil mit der Hürde der Verfahrensaussetzung (liegt im Ermessen des Gerichts) oder dem Versuch einer Anfechtung nach § 2079 BGB (Übergehung eines Pflichtteilsberechtigten) zurückgreifen wollen.