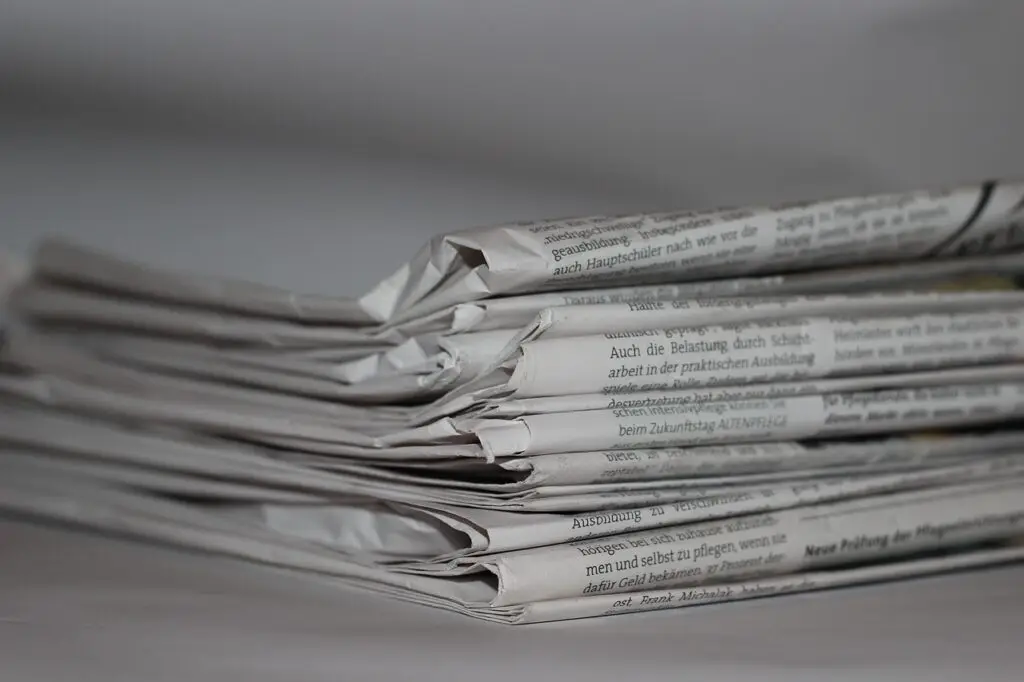Eine der häufigsten Fragen bei der Übertragung von Immobilien auf die nächste Generation lautet: Wie können wir sicherstellen, dass die 10-Jahres-Frist für Pflichtteilsergänzungsansprüche (§ 2325 BGB) auch wirklich zu laufen beginnt? Besonders bei einem vorbehaltenen Wohnungsrecht für die Übergeber herrschte oft Unsicherheit.
Ein aktuelles Urteil des Oberlandesgerichts München (Az. 33 U 2755/24 e) bringt hier mehr Klarheit und zeigt, wie entscheidend die Details im notariellen Übergabevertrag sind.
Der vom OLG entschiedene Fall
Im konkreten Fall hatten Eltern ihrem Sohn bereits im Jahr 2006 ihr Hausgrundstück übertragen. Im notariellen Vertrag behielten sie sich ein lebenslanges Wohnungs- und Nutzungsrecht vor. Der entscheidende Punkt war jedoch die Ausgestaltung dieses Rechts:
Das Wohnrecht bezog sich nur auf das Erdgeschoss, einen Kellerraum und Teile der Garage.
Das gesamte erste Obergeschoss wurde dem Sohn zur alleinigen und ausschließlichen Nutzung übergeben.
Dem Sohn wurde vertraglich gestattet, umfangreiche Um- und Anbauten vorzunehmen.
Der Sohn durfte das Grundstück sogar mit Grundpfandrechten bis 170.000 € belasten, die dem Wohnrecht im Rang vorgingen.
Mehr als 15 Jahre nach der Übertragung verstarb der Vater. Seine Tochter aus erster Ehe forderte daraufhin Pflichtteilsergänzungsansprüche und argumentierte, die 10-Jahres-Frist habe nie zu laufen begonnen, da der Vater durch sein Wohnrecht den „Genuss“ am Haus nie aufgegeben habe.
Die Entscheidung: Der Übergeber war nicht mehr „Herr im Haus“
Das OLG München wies die Klage ab und gab der Erbenseite recht. Die Richter stellten klar, dass die 10-Jahres-Frist im Jahr 2006 mit der Umschreibung im Grundbuch begonnen hatte und bei Eintritt des Erbfalls längst abgelaufen war.
Die Begründung des Gerichts ist ein wichtiger Leitfaden für die Vertragspraxis: Eine Schenkung gilt dann als „geleistet“, wenn der Schenker den verschenkten Gegenstand nicht mehr im Wesentlichen weiternutzt. Im vorliegenden Fall konnten die Eltern eben nicht mehr nach Belieben über das gesamte Anwesen verfügen. Der Sohn konnte einen wesentlichen Teil der Immobilie exklusiv nutzen und war zu weitreichenden eigenen Maßnahmen (Umbau, Beleihung) berechtigt. Die Eltern waren somit nicht mehr die alleinigen „Herren im Haus“. Das Gericht betonte, dass es auf die rechtlich vereinbarte Gestaltung im Notarvertrag ankommt.
Praxishinweis und verbleibende Risiken
Das Urteil stärkt die Rechtssicherheit für durchdacht gestaltete Übergabeverträge. Es zeigt aber auch, wie präzise gearbeitet werden muss. Hätten sich die Eltern ein Wohnrecht am gesamten Haus vorbehalten, wäre der Fall anders ausgegangen.
Vorsicht ist geboten, wenn die vertragliche Regelung von der Realität abweicht. Wird – wie in unserem Beispiel – nur ein Wohnrecht für eine Etage eingetragen, die Eltern aber faktisch weiterhin das ganze Haus nutzen, verbleibt ein Risiko. Zwar stellt das Gericht auf die rechtliche Vereinbarung ab, doch eine solche Diskrepanz kann zu erheblichen Streitigkeiten führen. Für den Pflichtteilsberechtigten besteht zwar ein Nachweisproblem, doch wenn eine solche Nebenabrede beweisbar ist, könnte sie sogar die Formnichtigkeit des gesamten Vertrages nach § 311b BGB zur Folge haben.